Die Neuwahlen liegen hinter uns, eine neue Regierung hat sich formiert und in einem Koalitionsvertrag bereits aufgezeigt, welche Änderungen sie für die kommenden Monate und Jahre andenkt. Auch darüber hinaus ist das Energierecht gewohnt agil: Es gibt Neues im Bereich der Nachhaltigkeitsberichterstattung, bedingt Neues zum Kundenanlagenstatus und ein (hoffentlich) letztes To-Do bei den Energiepreisbremsen. Zudem geben wir allen, die gerade mitten in der Antragsphase stecken, Last-Minute-Tipps an die Hand. Viel Freude bei der Lektüre!
Auf einen Blick:

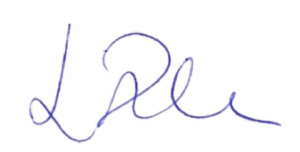
Lena Ziska
ziska@ziska-talhof.de

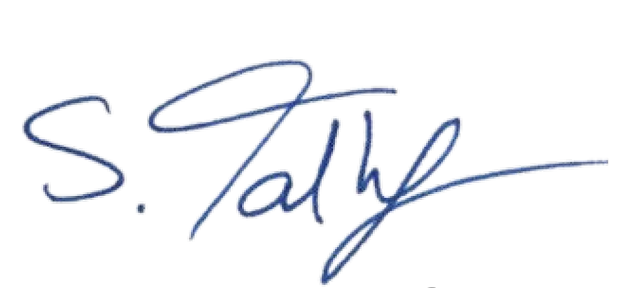
Sandra Talhof
talhof@ziska-talhof.de
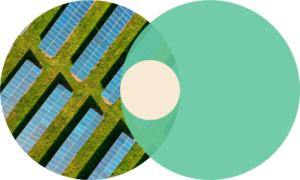
"Energie" im Koalitionsvertrag: (Wie) Können Unternehmen sich vorbereiten?
Im April/Mai diesen Jahres einigten sich die neuen Regierungsparteien CDU/CSU und SPD auf einen Koalitionsvertrag. Wir zeigen, welche wesentlichen Punkte dieser im Bereich „Energie“ bereithält und welche Vorkehrungen Unternehmen treffen können.Im Koalitionsvertrag halten die Regierungsparteien übergeordnet fest, dass ein Einklang aus Klimaschutz, wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit und sozialer Ausgewogenheit erreicht und zudem Bürokratie abgebaut werden soll. Auf rund 8 Seiten wird beschrieben, wie dies im Kontext Energie & Klima gelingen soll. Einige wesentliche Punkte:
Absenkung der Energiepreise
Die Energiekosten sollen signifikant sinken – und zwar um mindestens 5 ct/kWh. Hierfür sind u.a. Maßnahmen wie die Abschaffung der Gasspeicherumlage und die Reduzierung von Netzentgelten und Umlagen vorgesehen. Besonders relevant:
Absenkung der Stromsteuer
Die Koalitionsparteien sehen eine Absenkung der Stromsteuer auf das europäische Mindestmaß vor. Dieses Mindestmaß liegt bei 0,05 ct./kWh. Dieser Stromsteuersatz gilt schon jetzt bei Geltendmachung der entsprechenden Steuerentlastung nach § 9b StromStG für Unternehmen des produzierenden Gewerbes – künftig soll er auf „alle“ ausgeweitet werden.
Industriestrompreis
Für „anderweitig nicht weiter zu entlastende energieintensive Unternehmen“ wird im Koalitionsvertrag ein sog. Industriestrompreis vorgeschlagen. Hierzu ist vieles unklar, z.B.:
- Kommt der Industriestrompreis nur für Unternehmen in Betracht, die keine andere Beihilfe (bspw. BesAR) in Anspruch nehmen können?
- Wie soll der Industriestrompreis funktionieren?
- Wird es ein Antragsverfahren geben?
Unser Tipp: Sprechen Sie mit Ihren Fachverbänden, um eine praxistaugliche Ausgestaltung dieses Instruments zu erwirken.
Netzentgelte
Ein wichtiger Hebel bei der Absenkung der Energiekosten wird die Reduzierung der Netzentgelte sein. Dies führt zunächst einmal zu einem Umbruch des aktuellen Systems. Hier gibt es bereits Bewegung, insb. aufgrund der Tatsache, dass die StromNEV Ende 2028 außer Kraft tritt:
Zur vorzeitigen Abschaffung der 7.000-Stunden-Regelung und der Atypik haben wir bereits in unserem Newsletter Q1/2025 ausgeführt. Nun kommt ein Festlegungsverfahren (BK8-25-003-A) der Bundesnetzagentur (BNetzA) zur vorzeitigen Abschaffung des singulären Netzentgelts hinzu. Stellungnahmen zum Festlegungsentwurf können bis zum 08.07.2025 eingereicht werden. Für Industrieunternehmen, die das singuläre Netzentgelt in Anspruch nehmen, dürfte in den meisten Fällen eine Übergangsregelung bis zum 31.12.2028 greifen. Die BNetzA will zu einem späteren Zeitpunkt prüfen, ob es eine Nachfolgeregelung für das singuläre Netzentgelt geben kann.
Unser Tipp: Beteiligen Sie sich bereits an dem Konsultationsverfahren, wenn Sie von einem singulären Netzentgelt profitieren und legen Sie der BNetzA die Gründe für einen vermiedenen Direktleitungsbau dar, um eine Anschlussregelung ab 2029 zu verteidigen.
Verlängerung und Ausweitung der Strompreiskompensation
Außerdem soll laut Koalitionsvertrag die Strompreiskompensation dauerhaft verlängert und auf weitere Branchen ausgeweitet werden. Näheres hierzu können Sie dem Beitrag „Last-Minute-Tipps rund um Ihre BECV-, BesAR- und SPK-Anträge“ ganz unten in diesem Newsletter entnehmen.
Weitere Vorhaben der Koalitionsparteien
Über das große Ziel der Absenkung der Energiekosten hinaus, haben sich die Koalitionsparteien darauf geeinigt, u.a. folgende Punkte vorantreiben zu wollen:
- Erneuerbare Energien sollen verstärkt genutzt werden. Ein großer Fokus liegt dabei auf der systemdienlichen Ausgestaltung und Einbindung der EE-Anlagen in das Stromnetz. Letzteres soll hierfür ausgebaut und modernisiert sowie mit dem EE-Ausbau synchronisiert werden.
- Um erneuerbare Energien flexibler nutzen zu können, sollen Speicherkapazitäten systemdienlicher ausgebaut werden. Hierfür ist eine Privilegierung von Energiespeichern vorgesehen.
- Der nationale Emissionshandel soll fließend in den EU-ETS 2 überführt werden – dazu soll es Instrumente geben, die CO2-Preissprünge vermeiden. Zudem ist eine Kompensation carbon-leakage-gefährdeter Unternehmen vorgesehen – möglicherweise könnte diese der BECV nachgebildet werden. Hierzu fehlen derzeit noch Entwürfe.
CSRD: Neues aus dem Omnibus-Paket
Viele Unternehmen bereiten sich auf die Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichts vor. Mit dem Omnibus-Paket hat die EU nun einige Erleichterungen vorgeschlagen bzw. diese bereits umgesetzt.Auf EU-Ebene ist die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), die Nachhaltigkeitsberichterstattungsrichtlinie, bereits Anfang 2023 in Kraft getreten und sollte bis zum 6. Juli 2024 in nationales Recht überführt werden. In Deutschland ist dies bislang nicht geschehen, sodass die Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung bis zur Überarbeitung des Handelsgesetzbuchs (HGB) noch kein national geltendes Recht ist.
Noch bevor in Deutschland eine Umsetzung erfolgt ist, gibt es Neues aus der EU: Die „Stop-the-Clock“-Richtlinie ist in Kraft getreten. Diese ist Teil des sog. „Omnibus-Pakets“, mit dem sich überschneidende Berichtspflichten aus der CSRD, der europäischen Lieferkettenrichtlinie CSDDD und der EU-Taxonomie-Verordnung vereinheitlicht und so vereinfacht werden sollen.
Die „Stop-the-Clock„-Richtlinie betrifft den Zeitrahmen der CSRD und ändert den Startschuss für die Berichterstattungspflicht für Teile des Adressatenkreises ab, indem sie diesen um 2 Jahre verschiebt. Einen (vereinfachten) Überblick gibt diese Grafik: CSRD
Über die Anpassung des Zeitrahmens hinaus beinhaltet das Omnibus-Paket inhaltliche Vorschläge zur Vereinfachung der Berichterstattungspflichten wie die Streichung der CSR-Berichtspflicht für börsennotierte KMU oder die Anhebung des Schwellenwerts der Pflicht zur Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichts auf 1.000 Mitarbeitende. Diese inhaltlichen Vorschläge bedürfen noch der Zustimmung unterschiedlichster Akteure (EU-Parlament, Mitgliedstaaten etc.), was als schwierig gilt.
Auswirkungen des EuGH-Urteils zur Kundenanlage
Nach Auffassung des Europäischen Gerichtshofs ist Deutschland mit der nationalen Definition der sog. Kundenanlage über das Ziel hinaus geschossen. Welche Auswirkungen sind nun für Industriestandorte zu erwarten?Die „Kundenanlage“ steht seit einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) auf dem Prüfstand. Aber was ist eine Kundenanlage im Sinne des EnWG überhaupt? Mit einem Wort lässt sich der abstrakte Begriff der Kundenanlage mit „Standort“ übersetzen. Dabei hat die Einordnung eines Standorts als Kundenanlage weitreichende Auswirkungen.
Bisherige Kundenanlage und ihre Vorteile
So grenzt sich die Kundenanlage vom Netz ab. Netze unterliegen der Regulierung – Kundenanlagen nicht. D.h. innerhalb von Kundenanlagen werden für die Nutzung der Leitungsinfrastruktur keine Netzentgelte und keine netzbezogenen Umlagen (insb. KWK-Umlage, Offshore-Netzumlage, Aufschlag für besondere Netznutzung etc.) erhoben. Dadurch erfreut sich die Kundenanlage bislang insbesondere bei Eigenerzeugungsanlagen großer Beliebtheit, denn auf die in der Kundenanlage erzeugten Strommengen fallen keine Netzentgelte und netzbezogenen Umlagen an, unabhängig davon, ob der erzeugte Strom selbst oder von anderen Unternehmen am Standort verbraucht wird. Denn ohne Netzberührung werden eben jene Stromkostenbestandteile nicht ausgelöst.
Aber auch neben der Eigenerzeugung schafft die Kundenanlage Vereinfachungen und Erleichterungen, indem sie anders als das Verteilernetz nicht von der Regulierungsbehörde genehmigt werden muss und auch andere Netzbetriebs- und Veröffentlichungspflichten den Betreiber einer Kundenanlage nicht betreffen. Und auch darüber hinaus wird die Kundenanlage vielfach herangezogen, um Ausnahmen zu schaffen, z.B. beim sog. Versorgerstatus im Stromsteuerrecht, der trotz Stromweiterleitung nicht greift, wenn der Strom innerhalb einer Kundenanlage weitergegeben wird.
Und damit soll nun alles vorbei sein? Könnte man meinen, wenn man die ein oder andere Interpretation der Gerichtsurteile liest. Dabei steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts fest. Wir möchten den Entwicklungsstand für Sie einordnen: Was ist passiert?
Einordnung der Kundenanlagen-Urteile von EuGH und BGH
Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte in einem Verfahren darüber zu entscheiden, ob ein konkreter Sachverhalt, in dem in KWK-Anlagen erzeugter Strom an ca. 200 Mieter am Standort weiterverkauft wurde, die Kriterien einer Kundenanlage noch erfüllt. Der BGH hat das Verfahren zunächst ausgesetzt und eine Vorabanfrage an den EuGH gerichtet. Der EuGH hat daraufhin geurteilt (C-293/23), dass die Vorgaben der Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie die Einordnung des konkreten Sachverhalts als Kundenanlage nicht zulassen und der Betreiber den Verpflichtungen eines Verteilnetzbetreibers zu unterliegen hat. In dem zugrundeliegenden Verfahren wurde am Standort erzeugter Strom an 200 Wohneinheiten verkauft. Daraufhin hat auch der BGH den Beschluss (EnVR 83/20) erlassen, dass in dem Sachverhalt keine Kundenanlage vorliegt.
Damit ist die Kundenanlage gleichwohl nicht gänzlich vom Tisch. Vielmehr ist der Gesetzgeber nun aufgerufen, die Ausnahmen, die die Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie für einen nicht regulierten Bereich vorsieht, auszuloten und die Grenzen des Europarechts zu wahren. Wir warten somit gespannt auf eine neue Definition.
Reminder: Arbeitsplatzerhaltungspflicht im Kontext der Energiepreisbremsen
Unternehmen, denen im Kalenderjahr 2023 ein Entlastungsbetrag von mehr als 2 Mio. Euro aus den Energiepreisbremsen gewährt wurde, sollten nun ein (hoffentlich) letztes Mal aktiv werden.Durch die Energiepreisbremsen für Strom, Erdgas und Wärme wurden viele Unternehmen von den hohen Energiepreisen im Jahr 2023 entlastet. Mit dieser finanziellen Entlastung gingen jedoch zahlreiche Pflichten einher. Eine davon: Die Erhaltung von Arbeitsplätzen – zu erfüllen von Unternehmen, die Entlastungen oberhalb von 2 Mio. EUR in Anspruch nehmen wollten.
In diesem Kontext hatten Unternehmen zwei Optionen:
- Option 1: Abschluss einer Betriebsvereinbarung oder eines Tarifvertrags mit einer Regelung zur Beschäftigungssicherung für die Dauer bis mind. 30. April 2025
- Option 2: Schriftliche Erklärung über das Nichtzustandekommen einer Betriebsvereinbarung / eines Tarifvertrag und Erklärung des Letztverbrauchers, in der er sich verpflichtet, bis mind. zum 30.04.2025 eine Belegschaft zu erhalten, die mind. 90% der am 01.01.2023 vorhandenen Arbeitsplatz-Vollzeitäquivalente entspricht
Wer die erste Option gewählt hat, muss seitens der Preisbremsengesetze StromPBG und EWPBG nichts weiter tun und kann diesen Beitrag im Grunde überspringen.
An die zweite Option hingegen knüpft sich nun ein weiteres To-Do an, das Sie nicht aus dem Blick verlieren sollten: Zum Nachweis der Erfüllung dieser Pflicht ist nun ein testierter Abschlussbericht bei der Prüfbehörde einzureichen, der die Arbeitsplatzentwicklung im relevanten Zeitraum 01.01.2023 bis 30.04.2024 darstellt. Eine gesetzliche Frist zur Abgabe dieses Abschlussberichts existiert nicht – die Gesetzesbegründung wie auch die FAQ des BMWE geben aber den 31.12.2025 vor. Laut FAQ hat eine Stichtagsbetrachtung zu erfolgen – d.h. eine „Gesamtzählung jeweils zum 1. Januar 2023 und 30. April 2025“. Wurden Arbeitsplätze abgebaut, sind die Gründe hierfür darzulegen.
Wird der Nachweis nicht oder nicht erfolgreich geführt, droht eine ganze oder teilweise Rückforderung der gewährten Entlastung oberhalb von 2 Mio. EUR nebst Zinsen.
Last-Minute-Tipps rund um Ihre BECV-, BesAR- und SPK-Anträge
Die Antragsfrist zum 30.06.2025 rückt näher. Auf dem Weg dieses Endspurts wollen wir Ihnen ausgesuchte Tipps an die Hand geben.Die Jahresmitte zum 30.06. vereint die Antragsfristen von gleich drei Verfahren: die Besondere Ausgleichsregelung (zur Reduzierung der KWK- und Offshore-Netzumlage), die BECV-Beihilfe (für die Entlastung der CO2-Kosten aus dem nationalen Emissionshandel) und die Strompreiskompensation (für eine Beihilfe der indirekten Zertifikatskosten aus dem Europäischen Emissionshandel Teil 1). Wir führen die Antragstellungen für viele unserer Mandanten durch und geben denjenigen, die selbst tätig werden, mit diesem Beitrag noch ein paar Last-Minute-Tipps an die Hand, die wir in diesem Jahr als besonders beachtenswert einstufen:
Besondere Ausgleichsregelung
Das allgegenwärtige Thema der ökologischen Gegenleistungen nimmt auch bei der Besonderen Ausgleichsregelung an Fahrt auf. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) hat neue Nachweisunterlagen veröffentlicht, um die Auflistung der umgesetzten Energieeffizienzmaßnahmen und die Bestätigung der prüfungsbefugten Stelle zu dokumentieren. Die Vorlage kann auch für die Nachweisführung der vergangenen Antragsjahre verwendet werden, sofern Sie in dem Antragsjahren 2023 und 2024 zunächst Verpflichtungserklärungen abgegeben haben.
Der in unseren Augen wichtigste Tipp zur Besonderen Ausgleichsregelung besteht darin, noch in diesem Jahr die erforderlichen wirtschaftlichen Energieeffizienzmaßnahmen umzusetzen, die Sie für die Nachweisführung im Antrag nächstes Jahr benötigen. Denn in 2026 ist keine Abgabe einer Verpflichtungserklärung mehr möglich. Auch ist ab 2026 besondere Vorsicht geboten, wenn Sie den Beihilfebetrag nur teilweise in wirtschaftliche Maßnahmen investieren. Das BAFA verlangt in dieser Variante den Einsatz von 100% der Beihilfesumme – im Zweifel in unwirtschaftliche Maßnahmen. Auch die Definition der Wirtschaftlichkeit ändert sich ab 2026 – seien Sie vorbereitet.
BECV-Beihilfe
Die Deutsche Emissionshandelsstelle (DEHSt) erleichtert die Nachweisführung der ökologischen Gegenleistungen im diesjährigen Antrag dergestalt, dass auf eine Prüfung der Wirtschaftlichkeit der prüfungsbefugten Stelle bei umgesetzten Maßnahmen verzichtet wird.
Die DEHSt hatte darüber hinaus in einer Info-Veranstaltung angekündigt, keine Bestätigung eines Zertifizierers zu fordern, wenn die erforderliche Investitionsschwelle erreicht wurde und der Brennstoffverbrauch unter 10 GWh liegt. Die Erleichterung sollte vorerst nur für den Antrag 2025 gelten und gegebenenfalls auf Folgejahre ausgedehnt werden. Die Aussagen der DEHSt lassen sich im Hinweisblatt jedoch leider nicht wiederfinden, sodass an dieser Stelle Vorsicht geboten ist.
Im Hinweisblatt niedergeschrieben ist hingegen die Erleichterung, dass für das Abrechnungsjahr 2024 bei einer erwarteten Beihilfesumme von bis zu 100.000 EUR auf ein Wirtschaftsprüfertestat verzichtet werden kann bzw. die Prüftiefe vom Ansatz der „hinreichenden“ Sicherheit auf „begrenzte“ Sicherheit reduziert werden kann.
Ein Blick in die Zukunft: Die Tage der BECV-Beihilfe in ihrer aktuellen Form sind gezählt, da das nationale Emissionshandelssystem gemäß BEHG ab 2027 in das Europäische Emissionshandelssystem Teil 2 gemäß TEHG übergeht. Grundlage der BECV ist das BEHG, sodass mit der Ablösung der Systeme auch die BECV in der aktuellen Fassung keinen Bestand hat. Auch das neue System gibt grundsätzlich die Möglichkeit einer Kompensation – einen Entwurf für eine Anschlussregelung sucht man bislang jedoch vergebens.
Strompreiskompensation
Der wohl wichtigste Tipp zur Strompreiskompensation betrifft nicht das aktuelle Antragsjahr, sondern die im Koalitionsvertrag angekündigte Erweiterung der antragsberechtigten Branchen.
Aktuell profitieren nur ca. 350 Unternehmen deutschlandweit von dieser Entlastungsmöglichkeit, doch das könnte sich nun ändern. Laut Koalitionsvertrag gibt es das Bestreben, die Strompreiskompensation dauerhaft zu verlängern (die aktuelle Regelung läuft bis Ende 2030) und auf weitere Branchen auszuweiten. Konkreter wird diese Aussage nur in Bezug auf Rechenzentren. Welche weiteren stromintensiven und carbon-leakage-gefährdeten Branchen in den Kreis der Antragsteller aufgenommen werden könnten, steht aktuell noch nicht fest.
Anders als bei der BECV-Beihilfe sieht die Strompreiskompensation bislang kein geregeltes Antragsverfahren vor, wer wann und zu welchen Kriterien einen Antrag auf Aufnahme seiner Branche stellen kann. Auch war bislang eine Anpassung der Europäischen Beihilfeleitlinien nicht angekündigt.
Die Aussage im Koalitionsvertrag freut uns also sehr, lässt uns aber ein wenig ratlos zurück.
Unser Tipp: Wir empfehlen Ihnen, sich mit Ihrem jeweiligen Fachverband auszutauschen und das Thema in Richtung Politik zu adressieren, um im besten Fall eine Aufnahme Ihres Sektors zu dieser Beihilfe zu erreichen.
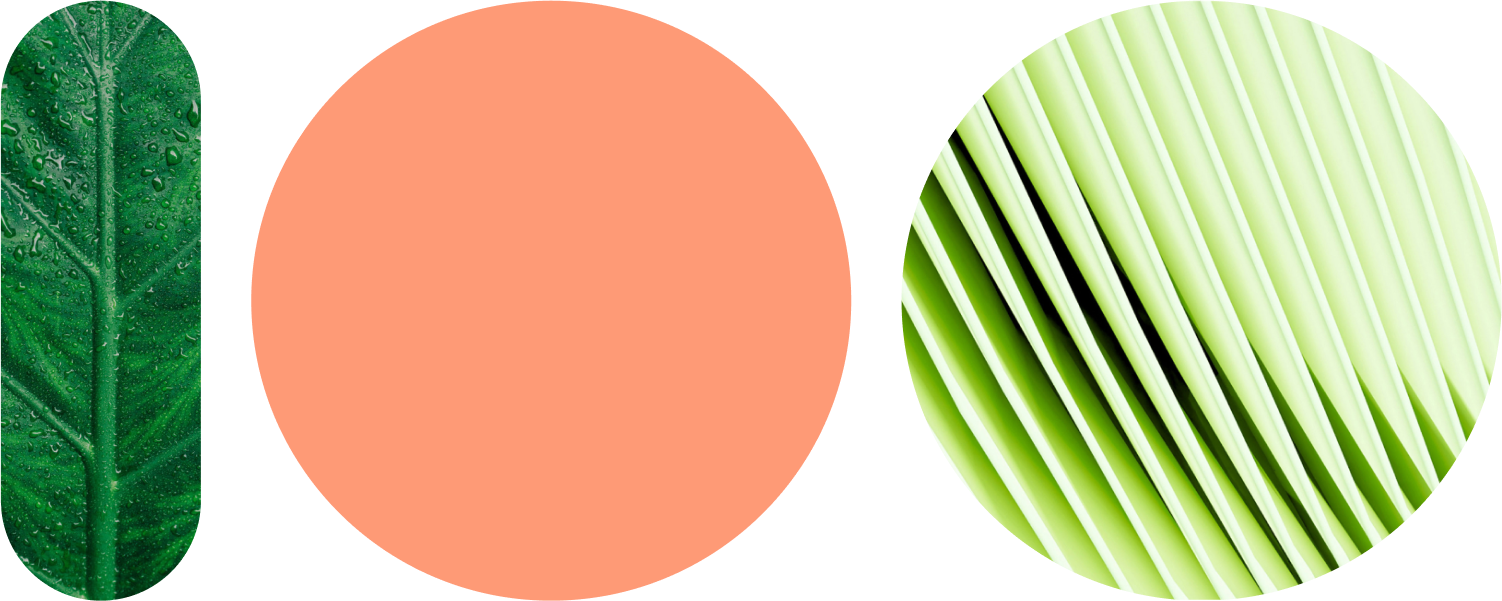
Schon jetzt ist absehbar, dass trotz Sommerpause keine Ruhe einkehrt. So sollen bereits kurzfristig erste Maßnahmen zur Senkung der Energiepreise vorgestellt und umgesetzt werden. Auch zur Kundenanlage wünschen wir uns in den nächsten Wochen/Monaten Aussagen, die Rechtssicherheit zurückbringen. Wir behalten diese und weitere Themen für Sie im Blick und informieren Sie! Bis dahin wünschen wir Ihnen einen schönen Sommer!
Jederzeit informiert?
Melden Sie sich jetzt zum Newsletter an:

